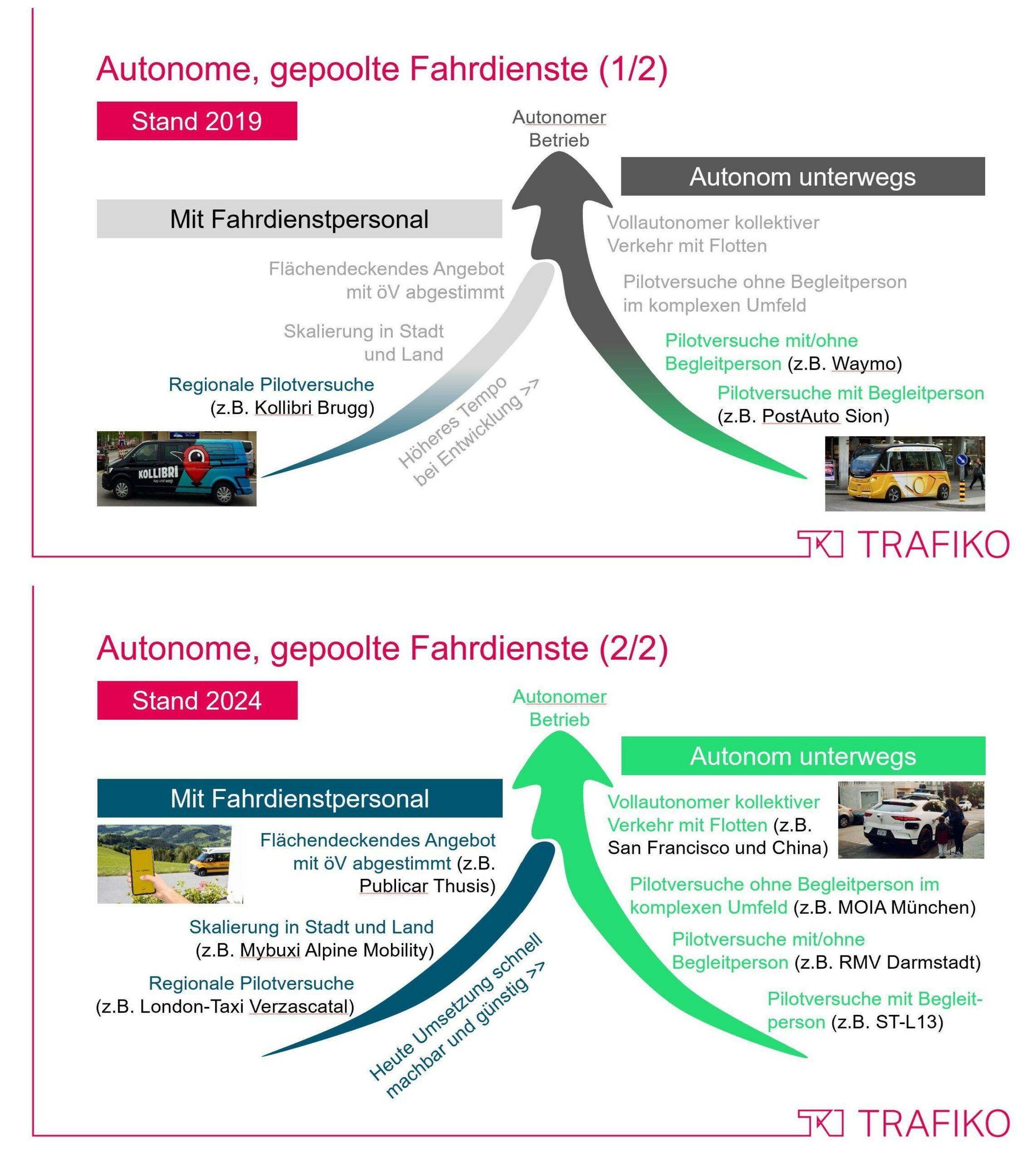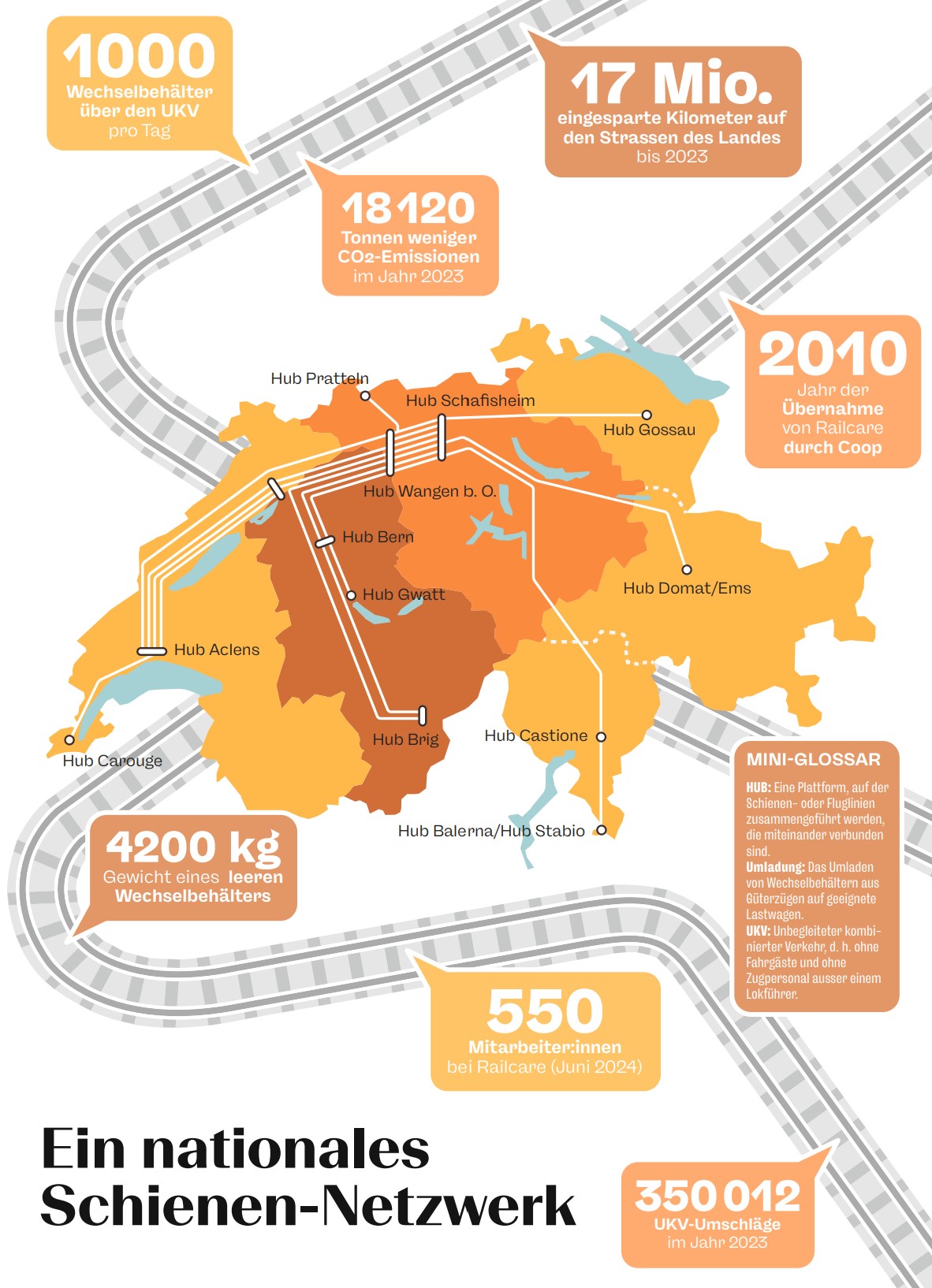Trafiko führt Gotthard-Komitee
Wir freuen uns, als neue Geschäftsstelle die 172-jährige Tradition des Gotthard-Komitees fortzuführen. Die offizielle Übergabe fand letzte Woche an der Generalversammlung im Landratssaal in Stans statt (vgl. Foto). Gemeinsam mit dem Vorstand – Fabian Peter (Präsident, Regierungsrat LU), Esther Keller (Regierungsrätin BS), Therese Rotzer (Regierungsrätin NW), Michele Rossi (Tessiner Handelskammer) und Florian Röthlingshöfer (Direktor der Schweizerischen Rheinhäfen) – sowie den Mitgliedern möchten wir neue Impulse für den Bahnverkehr auf der Nord-Süd-Achse setzen. Mit dem Gotthard- und dem Ceneri-Basistunnel wurden bereits bedeutende Meilensteine erreicht. Dennoch bleiben zentrale Herausforderungen bestehen – etwa die internationale Anbindung oder die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene.

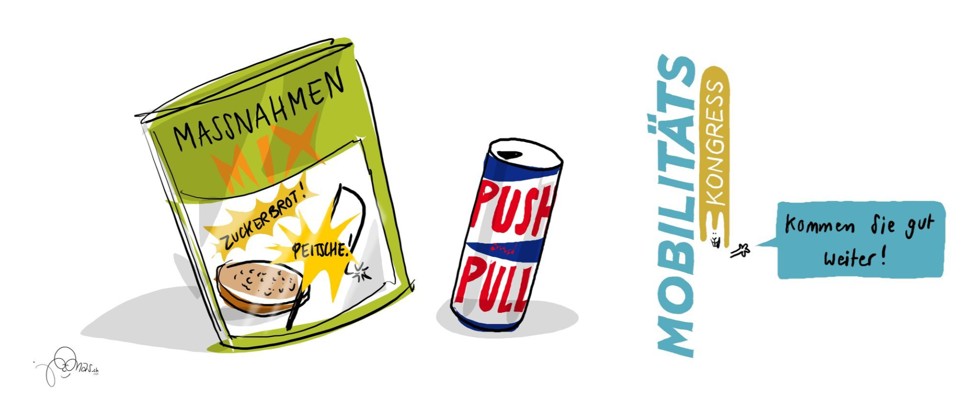 Am achten
Am achten 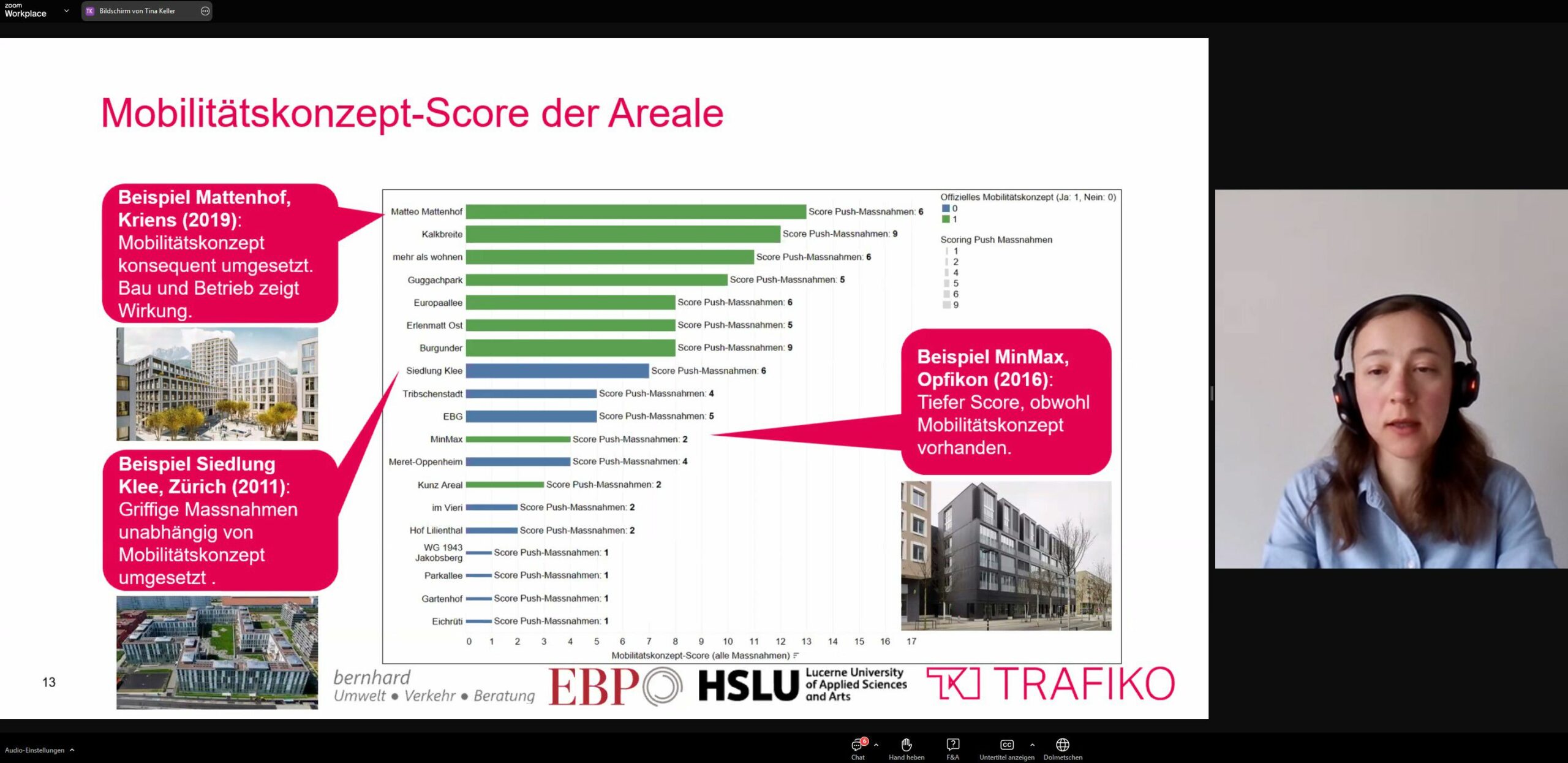 Gerne stellten wir am
Gerne stellten wir am