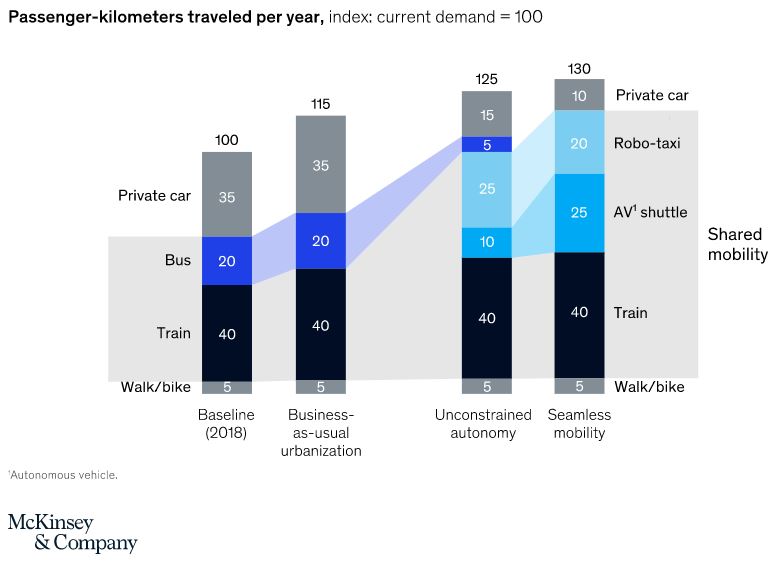Automobil

Gewisse sehen das Auto als einen der Gewinner der Coronakrise. So hat man doch im eigenen Gefährt am wenigsten Kontakt mit Mitmenschen. Die Autoindustrie bewirbt so auch die Kunden bereits aktiv, beispielsweise mit dem Slogan «Mit Abstand zusammenhalten». Da kommen viele Positivbotschaften und gar ein sympathischer Bastelbogen für Kids. Vom öV hörte man derweil, dass man sich in der Branche doch noch zu einer moderaten Entschädigung gewisser Abos durch gerungen hat, weil das Angebot nach unten angepasst wurde. Zudem gibts neue Empfehlungen zum Maskentragen zu Hauptverkehrszeiten, was die Attraktivität des öV nicht erhöht. Dabei ist das Auto keineswegs das künftige Heilmittel, wie schon die nun vermehrt laufenden MySchool-Sendungen sehr sachlich aufzeigt. In einer lebenswerten verdichteten Siedlung müssen Ressourcen geteilt, der Verkehr dosiert werden, damit das System funktioniert. Neuste Studien zeigen überdies, dass mehr als 50 Prozent der 6000 Befragte die Autokosten im Durchschnitt zu tief einschätzen. Beim Puzzleteil „Benzin“ ist die Schätzung noch gut, bei der Abschreibung beispielsweise um ein Vielfaches daneben. Die falsche Wahrnehmung dürfte ein wichtiger Grund dafür sein, warum die Autonutzung in Europa weiter ansteigt und die Verkehrswende bislang nicht gelingt. «Wären Autofahrer über die echten Kosten des Autofahrens informiert, könnte das den Autobesitz um bis zu 37 Prozent reduzieren», schließen die Forscher. Im Gegenzug: Informationen über die tatsächlichen Kosten des Autobesitzes erhöhen die Zahlungsbereitschaft für den öffentlichen Verkehr um 22 Prozent. Daran müsste man wohl auf dem Weg zurück zum Normalzustand nun verstärkt arbeiten. Im Spiegel wurden auch zahlreiche Ideen publiziert, wie der Wirtschaft auf die Beine geholfen werden könnte.