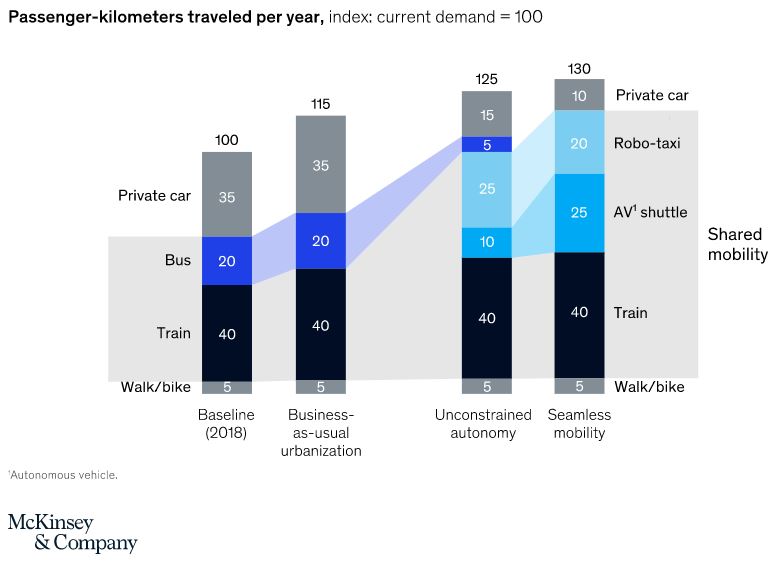Gerüchteküche
Jährlich werden etwa 90 Millionen Autos produziert, das sind 2,8 pro Sekunde. Ein relevanter Markt also. Während beim Wechsel der Antriebstechnik vieles geklärt ist, ist bei der Software das Rennen weiterhin offen. Im Focus wird prophezeit, dass 4 grosse Anbieter dereinst den Automarkt prägen werden: VW, Tesla, Baidu und Apple. Google/Android will sich offenbar eher auf die Autosoftware beschränken und nicht Hard- und Software als ein Produkt Auto anbieten, wie sie es übrigens beim Mobiltelefon auch machen. Microsoft hat kein eigenes Auto-Projekt, sondern gibt sich bei der Digitalisierung und Vernetzung mit Komponenten ein. Schauen wir, wer das Rennen macht.