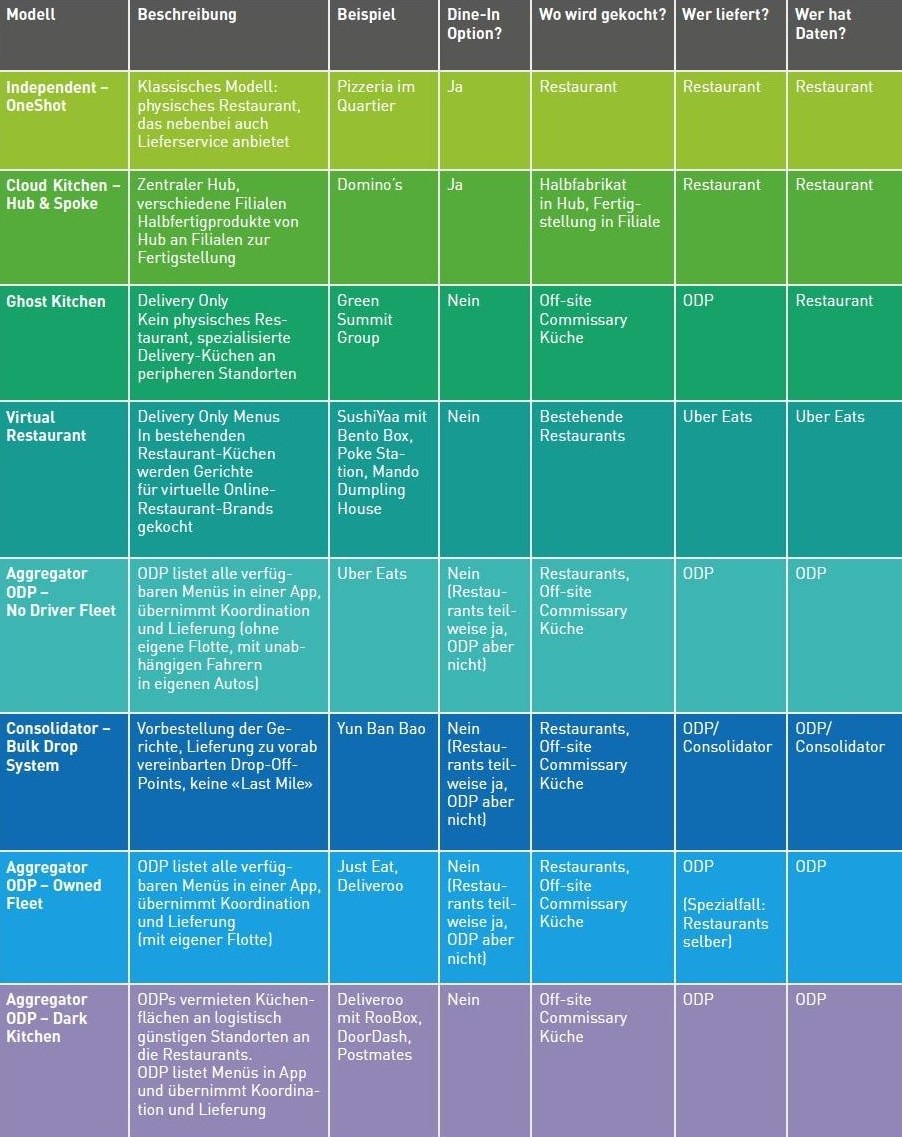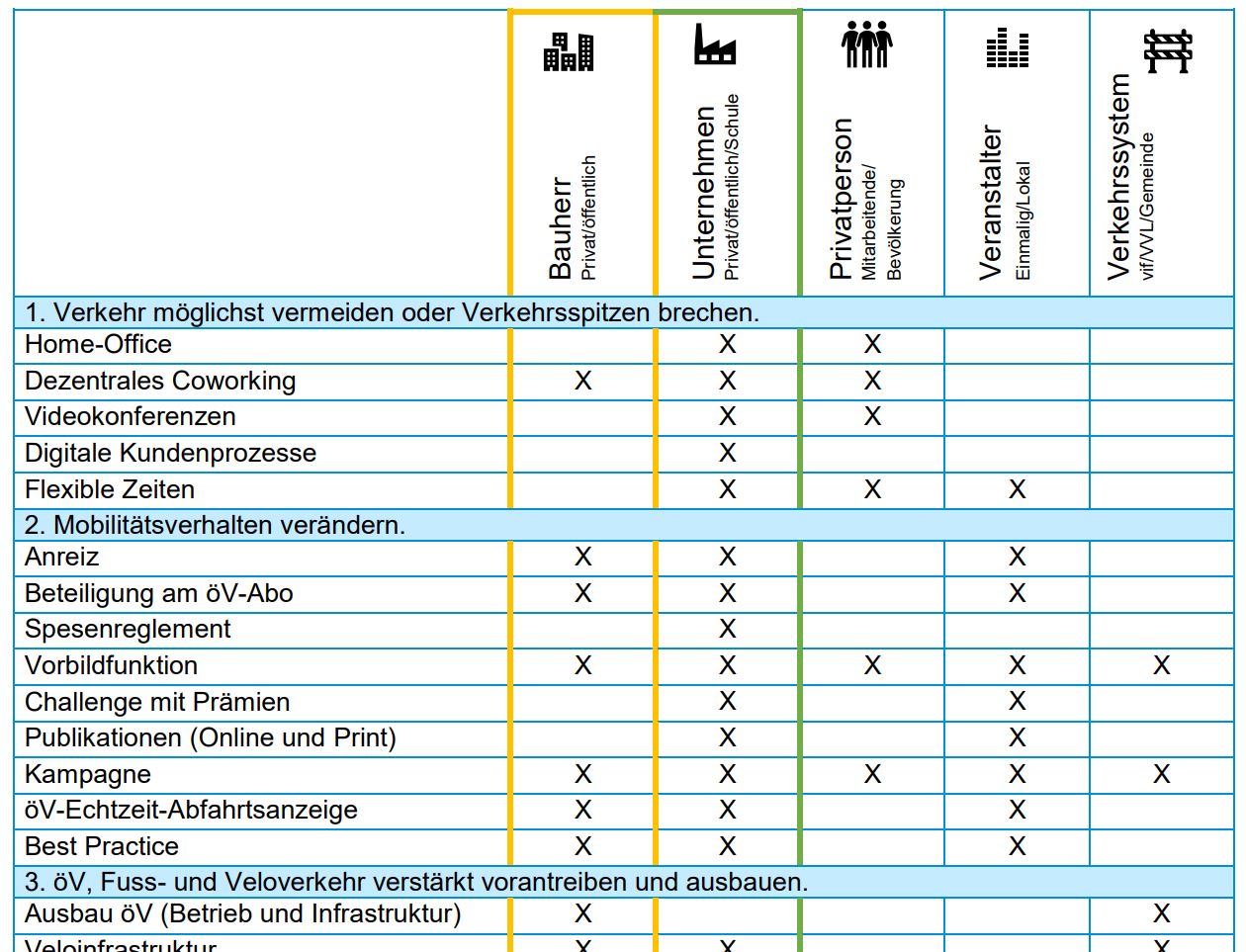Zickzack-Kurs
Volkswagen hatte die Autovermietung Europcar (248000 Fahrzeuge an 3835 Stationen in über 140 Ländern) in den späten 1990er Jahren übernommen, das Unternehmen dann aber 2006 für 1,26 Milliarden Euro verkauft, weil sich der Autobauer auf sein Kerngeschäft konzentrieren wollte. Gemäss Manager Magazin kommt nun die Kehrtwende: Eine Übernahme von Europcar sei eine attraktive Möglichkeit, Zugang zu einer Mobilitätsplattform zu erhalten. VW will also Zugang zur Infrastruktur und Technologie von Europcar und macht den aktuellen Hedgefonds-Eigentümern bereits das zweite, erhöhte Angebot über 2,5 Milliarden Euro. Der Verkauf kommt nun offenbar zu Stande. Willkommen zurück in der multimodalen Welt.